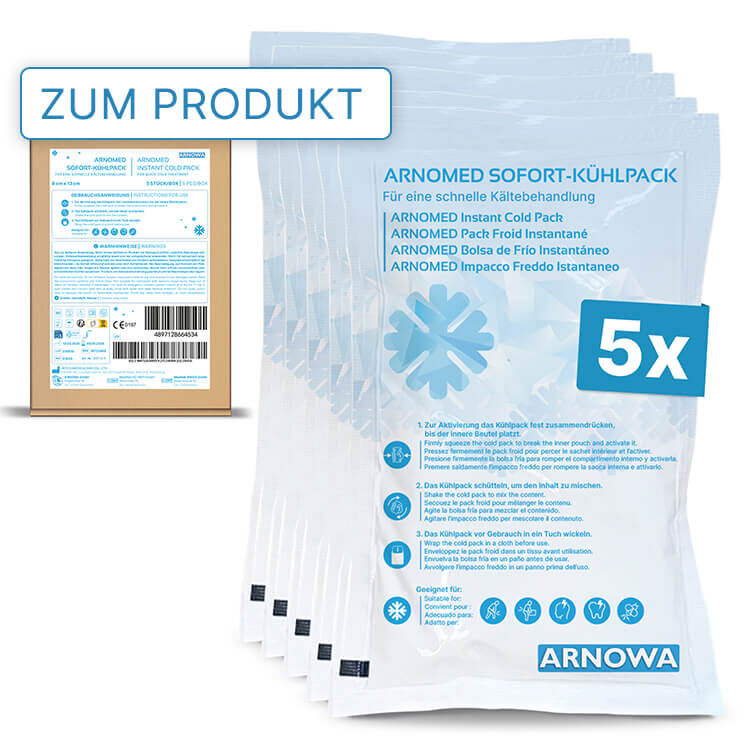Allergien - Symptome, Ursachen, Auslöser
Allergische Reaktionen können lebensbedrohliche Beeinträchtigungen hervorrufen. Um dem zu entgehen, finden sie hier eine Zusammenstellung wichtiger Informationen zu diesem Themenkomplex.
Allgemeines
Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem des Körpers auf Allergene beziehungsweise Antigene, sprich auf nicht-infektiöse Fremdstoffe. Zudem versucht der Körper während der allergischen Reaktion, Antikörper zu bilden.

Kontaktallergien treten auf, wenn die Person direkten Hautkontakt mit dem entsprechenden Allergen hatte. In diesem Fall kommt es zu Hautausschlägen oder Ekzemen.
Injektionsallergene gelangen durch Infusion oder Injektion in den Körper. Beispiele für Injektionsallergene sind unter anderem tierische Gifte, beispielsweise durch Bienen- oder Wespenstiche, Berührungen mit Quallen oder Feuerkorallen, sowie Medikamente.
Auf Injektionsallergene reagiert der Körper häufig anaphylaktisch. Diese anaphylaktischen Reaktionen können sich durch Hautirritationen, Störungen bestimmter Organfunktionen, durch einen Kreislaufschock mit anschließendem Organversagen und sogar durch tödliches Kreislaufversagen äußern. Jedoch muss es sich nicht zwingend um eine Allergie handeln, wenn eines der oben genannten Symptome auftritt. Es können beispielsweise auch eine Arzneimittelunverträglichkeit, eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz vorliegen.
Genetische Faktoren
Es ist einwandfrei belegt, dass für Kinder, deren Eltern Allergiker sind, ein erhöhtes Allergierisiko besteht. Es gibt jedoch nicht das eine Gen, das für eine Allergie verantwortlich ist.
Im Gegenteil: Es spielen mehrere genetisch bedingte Faktoren zusammen. Es gibt viele verschiedene Gene, die an der Entstehung einer Allergie-Erkrankung beteiligt sein können. Zudem sind unterschiedliche Allergien genetisch wahrscheinlich unterschiedlich determinierbar.
Nicht-genetische Faktoren einer Allergie
Gestörte Barrierefunktion der Haut
Eine Allergie kann auf eine gestörte Barrierefunktion der Haut zurückzuführen sein. Haut und Schleimhaut sind in diesem Fall durchlässiger als gewöhnlich und können dementsprechend nicht alle Allergene abwehren. Diese gestörte Barrierefunktion kann durch virale oder bakterielle Infekte sowie durch chemische Irritationen hervorgerufen werden.
Erhöhte Allergenexposition
Auch ein erhöhtes Allergenaufkommen kann Allergien verursachen, wenn die entsprechende Person ohnehin eine besondere Veranlagung, d.h. eine Anfälligkeit für Allergien aufweist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn man an seinem Arbeitsplatz verstärkt Allergenen ausgesetzt ist.
Stress
Stress ist nicht direkt die Ursache einer Allergie, doch er kann eine bereits bestehende Allergie intensivieren, da sowohl psychischer als auch körperlicher Stress das Immunsystem beeinträchtigt.
- Genetik
- Gestörte Hautbarrierefunktion
- Erhöhte Allergenexposition
- Stress
Sensibilisierung
Eine Allergie entsteht nicht von ungefähr. Voraussetzung für den Ausbruch einer Allergie ist eine Sensibilisierung. Von Sensibilisierung spricht man bei dem Erstkontakt mit einem Allergen und der entsprechenden Antwort des Immunsystems auf dieses Allergen. Hier treten zunächst keine Krankheitssymptome auf. Die Sensibilisierung kann jedoch mithilfe eines Blutbildes nachgewiesen werden.
Die Sensibilisierungsphase kann zwischen fünf Tagen und mehreren Jahren andauern. Erst nach dieser Zeit treten bei der betroffenen Person bei erneutem Kontakt mit dem entsprechenden Allergen Krankheitssymptome auf. Der Mensch reagiert also nicht beim Erstkontakt mit einem Allergen allergisch, sondern erst nachdem er bereits einmal sensibilisiert worden ist.
Kann man eine Sensibilisierung verhindern?
Um einer Allergie vorzubeugen, müsste man theoretisch den Kontakt mit jeglichen Allergenen vermeiden, um gar nicht erst sensibilisiert werden zu können. Dies ist in der Praxis jedoch unmöglich. Wie sollte man sich beispielsweise sein Leben lang vor Pollen schützen?
Man kann jedoch bestimmte Substanzen meiden, um von ihnen nicht sensibilisiert zu werden. Zu diesem Zwecke können beispielsweise Einmalhandschuhe und ein Mundschutz getragen werden. Zudem kann man beispielsweise den Gebrauch von Latexhandschuhen vermeiden und stattdessen auf Nitrilhandschuhe zurückgreifen, da das Risiko einer allergischen Reaktion bei Nitrilhandschuhen deutlich geringer ist als bei Latexhandschuhen.
Klinische Einteilung in Allergietypen
Coombs und Gell definierten im Jahre 1963 eine Einteilung in vier Allergietypen.
1. Soforttyp (Typ-I-Allergie)
Bei einer Typ-I-Allergie tritt die allergische Reaktion innerhalb weniger Sekunden bis zu Minuten auf. In manchen Fällen tritt jedoch auch eine zweite Reaktion nach etwa vier bis sechs Stunden auf. In diesem Fall spricht man von einer verzögerten Sofortreaktion.
Die allergische Reaktion wirkt sich beim Typen I durch eine entzündete Schleimhaut, Entzündungen auf der Haut oder durch eine systematische Entzündung des Körpers aus. Typische Allergien des Typen I sind unter anderem das allergische Asthma, Heuschnupfen, eine allergische Bindehautentzündung, Nesselsucht, Nahrungsmittel- sowie Arzneimittelallergien.
2. Zytotoxischer Typ (Typ-II-Allergie)
Dieser Allergie-Typ macht sich nach sechs bis zwölf Stunden bemerkbar. Hier werden durch die Bildung von Immunkomplexen aus zellwandständigen Antigenen mit zirkulierenden IgM- oder IgG-Antikörpern zytotoxische Killerzellen oder das Komplementsystem aktiviert. Dies führt zur Zerstörung von körpereigenen Zellen (Zytolyse). Typische Krankheiten dieser Typ-II-Allergie sind Agranuolzytose, Thrombopenie, Transfusionszwischenfälle sowie allergisch bedingte Hämolytische Anämie.
3. Immunkomplex-Typ oder Arthus-Typ (Typ-III-Allergie)
Ebenso wie die Typ-II-Allergie wirkt sich auch die Typ-III-Allergie nach sechs bis zwölf Stunden auf den Körper aus. Es bilden sich Immunkomplexe von Antigenen und Antikörpern, die sowohl an eine Zelle gebunden sein als auch frei im Blut schwimmen können.
Wie auch bei der Typ-II-Allergie wird das Komplementsystem aktiviert, welches zur Eliminierung zellulärer Antigene beitragen soll. Hierbei werden gewebeschädigende Enzyme freigesetzt. Typische Typ-III-Allergien sind die Serumkrankheit, exogen-allergische Alveolitis, die allergische Vaskulitis sowie die allergische bronchopulmonale Aspergillose.
4. Verzögerter Typ (Typ-IV-Allergie)
Bei der Typ-IV-Allergie handelt es sich um den Spättypen. Diese Allergieform kommt nach der Typ-I-Allergie am häufigsten vor. Sie erfolgt nach 12 bis 72 Stunden.
Hier werden Lymphokine aus bestimmten T-Lymphozyten freigesetzt. Diese aktivieren bzw. vermehren die Makrophagen sowie mononukleäre Zellen. Diese wandern anschließend an die Stelle des Körpers, die durch die Allergene belastet wird. Dies wiederum führt zu einer Entzündung und einer lokalen Infiltration. Häufige Krankheitserscheinungen der Typ-IV-Allergie sind allergische Kontaktekzeme, Arzneimittelexantheme, Tuberkulinreaktionen sowie Transplantatabstoßungen
Allergietests
Allergietests können in Form von Hauttests, Bluttests sowie Provokationstests gemacht werden. Positive Haut- sowie Bluttests weisen im Grunde keine Allergie nach, sondern bloß eine Sensibilisierung. Das heißt, selbst wenn eine Sensibilisierung nachgewiesen werden kann, sprich wenn der Allergietest positiv ist, muss es nicht zu körperlichen Beschwerden kommen.
Diese drei Testformen können noch weiter aufgegliedert werden. Bei Hauttests gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um das Allergenextrakt mit der Haut in Verbindung zu bringen: Es gibt den Prick-Test, den Prick-to-Prick-Test, den Reibetest, den Epikutantest, den Scratch-Test sowie den Intrakutantest.
In der Regel werden Hauttests am Unterarm oder am Rücken des Patienten durchgeführt.
Bei Provokationstests wird der Patient mit dem Allergen-Extrakt in jeglicher anderer Form in Kontakt gebracht. Dies kann durch Inhalation, über die Nahrung oder durch eine Flüssigkeit geschehen, die dem Patienten wie Nasenspray in die Nase gesprüht wird.
Bei den Haut- sowie bei den Provokationstests wird nach dem Kontakt des Patienten mit dem Allergenextrakt überprüft, wie der Körper auf das Allergen reagiert: Es können temporäre Hautrötungen, eine Schwellung der Nasenschleimhaut sowie Beeinträchtigungen der Lungenfunktion auftreten.
Bei den Blut-Allergietests wird das Blut auf bestimmte Stoffe untersucht, die Hinweise auf eine Allergie liefern könnten. Dies sind IgE-Antikörper, eosinophile kationische Proteine (ECP), Tryptase sowie Lymphozyten.
Eine weitere Möglichkeit ist die Hyposensibilisierung. Hier wird dem Patienten das Allergen über einen Zeitraum von drei Jahren regelmäßig und mit zunehmender Konzentration zugeführt.
Dies kann entweder durch Injektion erfolgen, oder durch die Einnahme von Tabletten oder Tropfen. Durch die regelmäßige Zufuhr des Allergens sinkt die Bereitschaft des Immunsystems, auf dieses Allergen zu reagieren. Allergien können auch mit Medikamenten behandelt werden. Dies kann jedoch ebensowenig wie die Allergenkarenz die allergische Erkrankung aufheben.
Die medikamentöse Behandlung einer Allergie kann höchstens die Symptome abschwächen. Es gibt einige unterschiedliche Möglichkeiten, um eine Allergie medikamentös anzugehen: Man kann Tabletten einnehmen, Augentropfen, Nasen- oder Asthmasprays benutzen, Salben auftragen oder sich bestimmte Mittel beim Arzt injizieren lassen.